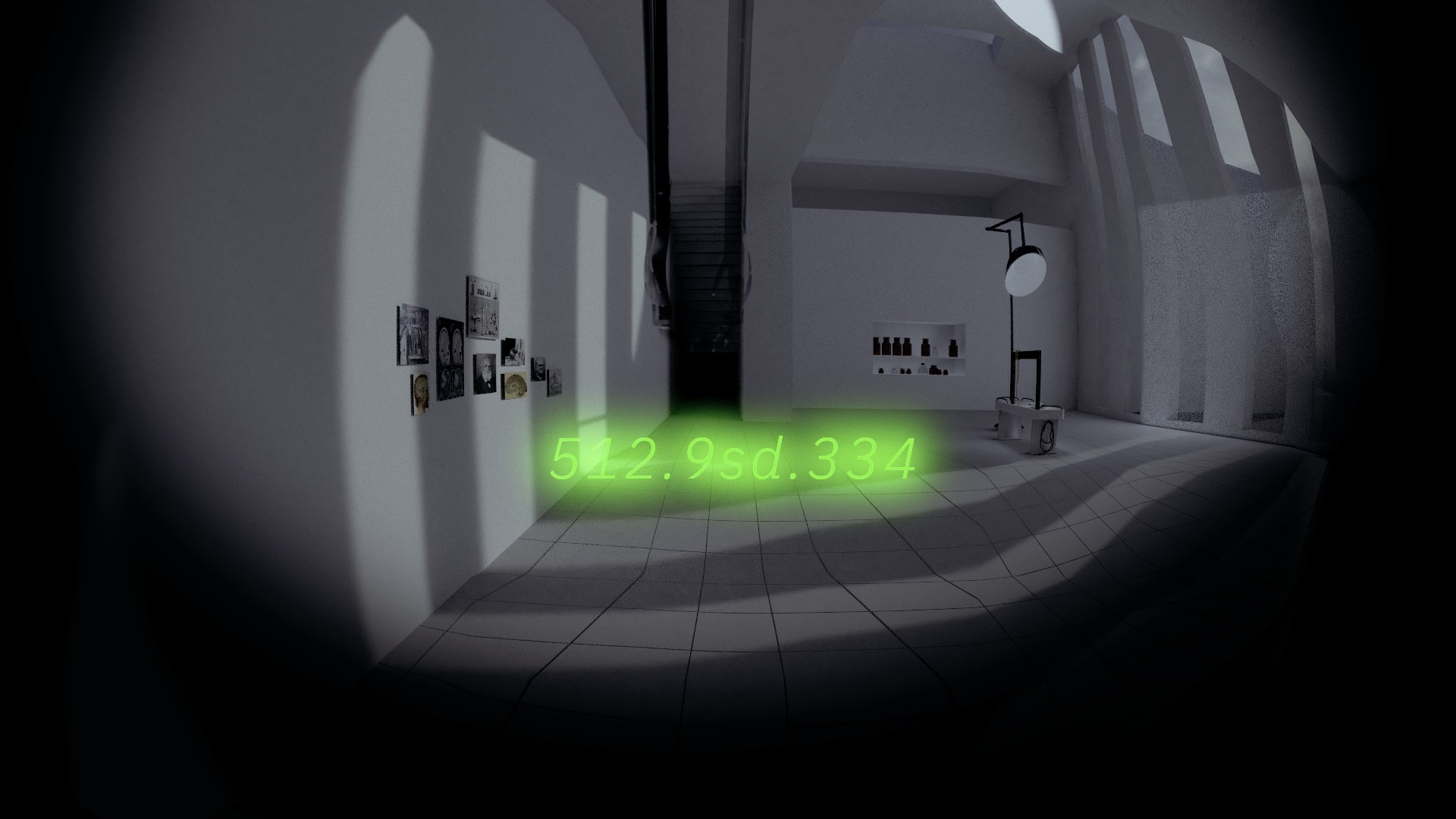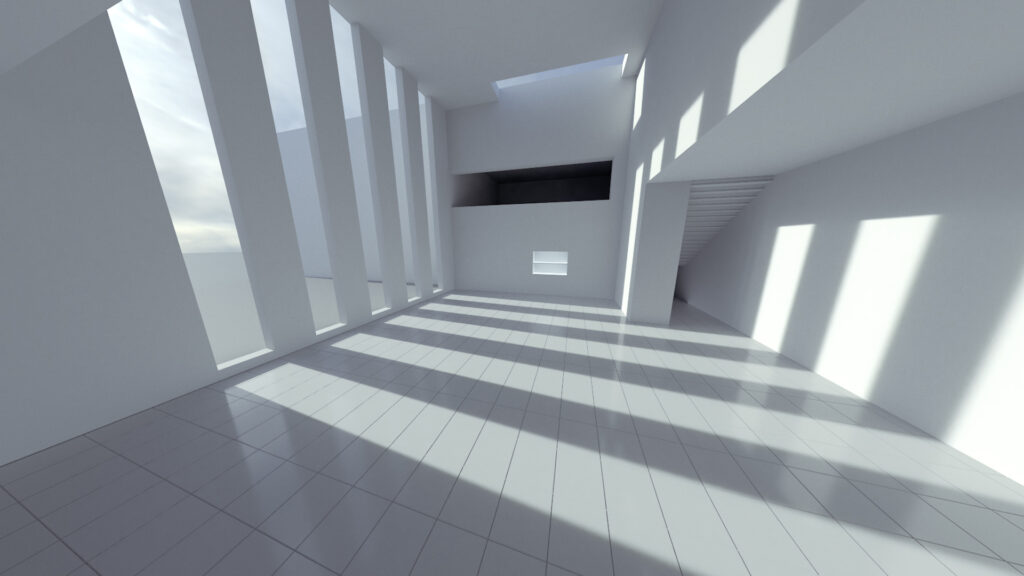




Suzanne wird von blinkenden Tasten und dem Sprachassistenten ihres Computers in eine virtuelle Traumwelt gelockt, die ihr eine Lösung für ihr Schlafproblem verspricht. In Wirklichkeit ist sie jedoch nur Teil eines großen wissenschaftlichen Experiments, bei dem ihr Verhalten gezielt manipuliert werden soll.
Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung ist Teil der sozialen Netzwerke. Daher spielen diese Plattformen eine immer größere Rolle als Wirtschaftsräume in der Online-Welt; und die Aufmerksamkeit der Nutzer wird zu einer kostbaren, aber knappen Ressource. Doch das Geschäftsmodell des kostenlosen Zugangs zu diesen Gemeinschaften birgt eine große Gefahr: Überwachung und Verhaltensänderung durch private Unternehmen, die mächtige Werkzeuge zur Manipulation entwickeln. Diese neue Technologie wird Attention Engineering genannt. Sie setzt sich aus Schnittstellendesign, Gamification und Deep Learning zusammen und macht sich psychologische Aspekte des menschlichen Verhaltens zunutze.